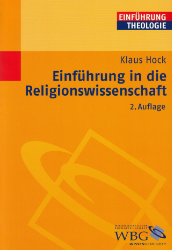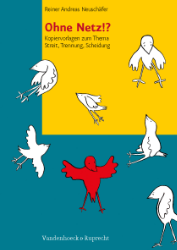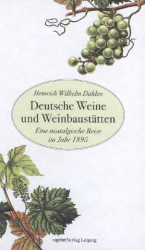Hiltmann, Gabrielle: Aspekte sehen
Bemerkungen zum methodischen Vorgehen in Wittgensteins Spätwerk. Die Autorin liest die Überlegungen zum Sprachspiel "Aspekte sehen" in Teil II der 'Philosophischen Untersuchungen' als implizite Reflexionen Wittgensteins auf den eigenen Sprachgebrauch und die Vorgehensweise im Spätwerk. Die Prämisse der radikalen Sprachimmanenz führt zur Frage, wie es Wittgenstein gelingt, in der Immanenz des Spielens von Sprachspielen Differenzen zu eröffnen, in denen der Sprachgebrauch im allgemeinen und der eigene im Spätwerk reflektiert werden können. Zur Beantwortung dieser Frage entwickelt die Autorin die These, 'Aspekte sehen' als eine Form des Blickwechsels in der Immanenz bilde eine Methodenfamilie des Spätwerks. 'Aspekte sehen' ist das Thema von II, xi der "Philosophischen Untersuchungen". Es werden zwei Verwendungen des Verbs 'sehen' unterschieden: Die Verwendungsweise 'dies sehen', bei der es möglich ist, das, was gesehen wird, durch das Zeigen auf den entsprechenden Gegenstand zu erklären, und 'Aspekte sehen', bei dem diese Möglichkeit nicht besteht. - Die Überlegungen zum Sprachspiel "Aspekte sehen" in Teil II,xi der 'Philosophischen Untersuchungen' werden von der Autorin als implizite Reflexionen Wittgensteins auf den eigenen Sprachgebrauch und die Vorgehensweise im Spätwerk gelesen. Dabei berücksichtigt sie insbesondere die häufige Verwendung von Wörtern aus dem Wortfeld von "sehen", die sie als Beschreibung dessen, was Wittgenstein in den Untersuchungen des Spätwerks tut, auslegt. Sie bezieht sich dafür insbesondere auf §§ 65 ff. der PU, wo Wittgenstein anhand des Wortes "Spiel" den Begriff "Familienähnlichkeit" entwickelt, und die §§ 89-133, wo das Philosophieverständnis des Spätwerks in Abgrenzung zum Tractatus dargestellt wird. Wittgensteins Aufmerksamkeit für den eigenen Sprachgebrauch gründet in der Einsicht, daß Sprache im Spielen von Sprachspielen als Instrument für bestimmte Funktionen eingesetzt wird, ohne daß dabei über das Instrument Sprache verfügt wird. Im Sprachgebrauch ist das Subjekt der Sprache unterworfen. Es wird vom Instrument Sprache gelenkt. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Anforderungen an den grammatikalisch korrekten Sprachgebrauch - Wittgenstein spricht vom Satzbau der "Oberflächengrammatik" -, sondern betrifft auch die "Tiefengrammatik". Die mit dieser Vokabel angesprochene Verschränkung von Sprachgebrauch und menschlicher "Lebensform" bildet eine sprachspielimmanente Grenze des Sagbaren, die für Bedeutung konstitutiv ist: "Das Unaussprechbare (das, was mir geheimnisvoll erscheint und ich nicht auszusprechen vermag) gibt vielleicht den Hintergrund, auf dem das, was ich aussprechen konnte, Bedeutung bekommt" (Vermischte Bemerkungen, S. 472, datiert 1931). "Aspekte sehen" bildet eine Art Technik des Blickwechsels von der funktionalen Gebrauchsbedeutung auf die instrumentale Verschränkung von Sprachgebrauch und Lebensform. Mittels dieser Technik kann Wittgenstein aus einer sprachimmanenten Position auf den Sprachgebrauch und die nichtreferentielle Konstitution von Bedeutung reflektieren. 124 Seiten, broschiert (Epistemata. Reihe Philosophie; Band 235/Königshausen & Neumann 1998) leichte Lagerspuren